Generative KI ist zum Taktgeber der digitalen Transformation geworden. Während neue Modelle und Funktionen die Schlagzeilen bestimmen, zeigt sich in den Unternehmen ein anderes Bild: Viele stehen noch am Anfang ihrer KI-Reise, erproben erste Szenarien und suchen nach Orientierung. Häufig fordert das Topmanagement klassische Kennzahlen wie den Return on Investment (ROI) als Entscheidungsgrundlage. Wichtiger ist jedoch die Frage, wie sich echter Business-Value erschliessen lässt und wie der Schritt von individueller Produktivität zur Optimierung ganzer Prozesse gelingt.

Pascal Brunner-Nikolla
Senior Manager und Head of Modern Work Switzerland
Pascal Brunner-Nikolla, Senior Manager und Head of Modern Work Switzerland bei Campana & Schott, begleitet seit mehr als zwei Jahren Unternehmen auf diesem Weg. Im Interview erläutert er, warum sich der Mehrwert von generativer KI nicht in ROI-Formeln fassen lässt, welche Use-Cases bereits heute greifen und worauf Organisationen achten sollten, wenn sie von ersten Pilotprojekten zur breiten Einführung und strategischen Nutzung übergehen.
Herr Brunner-Nikolla, die Diskussion über generative KI ist allgegenwärtig. Wie erleben Sie die Stimmung in den Unternehmen: eher Euphorie oder Zurückhaltung?
Beides. Viele Unternehmen spüren, dass hier ein Wendepunkt erreicht ist, und starten inzwischen auch grössere Vorhaben in Sachen generative KI. In den letzten zwei Jahren hatten viele Aktivitäten noch Pilotcharakter. Erste Anknüpfungspunkte fanden und finden Unternehmen meist in Anwendungen, die unmittelbar im Arbeitsalltag ansetzen – ein prominentes Beispiel ist M365 Copilot. Heute sehen wir immer häufiger Programme mit klaren Zielen, Budgets und Verantwortlichkeiten.
Gleichzeitig herrscht jedoch auch Unsicherheit. Viele beschreiben es, als stünden sie vor einem Berg, den noch niemand zuvor bestiegen hat.
Was wir beobachten: Ohne strategische Implementierung bleibt es in der Regel beim ersten Projekt und die Initiative läuft aus, ohne Impact zu erzielen.
Wo liegen aktuell die grössten Hürden, wenn es darum geht, den Schritt von ersten Pilotprojekten hin zu einer strategischen Implementierung zu schaffen?
Eine zentrale Hürde liegt darin, dass viele Unternehmen ohne ein stabiles Fundament starten. Oft fehlen saubere Berechtigungen, eine konsistente Klassifizierung von Informationen und klare Regeln für den Umgang mit Daten. Das führt zu Oversharing, also zum unbewussten oder zu grosszügigen Teilen von Inhalten ohne eindeutige Zugriffsbeschränkungen. Mit M365 Copilot werden solche Inhalte erst recht auffindbar, selbst wenn sie tief in Ablagen liegen. Deshalb braucht es klare Governance mit definierten Zugriffsrechten, Regeln und Verantwortlichkeiten.
Hinzu kommen strukturelle Punkte. Oftmals tun sich Unternehmen schwer, von einem Pilotprojekt zu einem grossen Roll-out zu gelangen. Der Grund: Die eigentliche Zielsetzung, die mit dem Vorhaben erreicht werden soll, wird häufig vernachlässigt. Dann rückt die ROI-Frage in den Vordergrund, die nicht unbedingt der zielführende Messwert ist. Es bleibt bei einem Bottom-up-Ansatz, bei dem der kulturelle Wandel und das AI-Mindset nicht gleich stark forciert werden können und Unternehmen dadurch nicht schnell zum einfach messbaren Mehrwert in den Prozessen gelangen.
Können Sie das näher erläutern: Weshalb greifen klassische Erfolgskennzahlen an dieser Stelle zu kurz?
Viele Führungskräfte im Topmanagement verlangen vor einer Investition eine belastbare ROI-Rechnung, da sie es so auch aus anderen Projekten kennen. Im Fall von Copilot und generativer KI greift dieser Massstab jedoch zu kurz. Persönliche Produktivität lässt sich nur schwer in klassische Finanzkennzahlen übersetzen. Selbst wenn Aufgaben schneller erledigt werden, verschwinden die Kosten nicht automatisch aus der Organisation, denn die frei werdende Zeit wird vielmehr für andere Tätigkeiten genutzt.
Es geht darum, Kompetenzen aufzubauen, Vertrauen zu schaffen und die Menschen in die Lage zu versetzen, den Wandel aktiv zu begleiten. – Pascal Brunner-Nikolla, Senior Manager und
Head of Modern Work Switzerland
Der eigentliche Mehrwert entsteht deshalb nicht durch reine Kosteneinsparungen, sondern durch die Möglichkeit, in gleicher Zeit mehr Wert zu schaffen. Genau das verstehen wir unter Business-Value. In unseren Assessments machen wir diesen greifbar, indem wir etwa kürzere Durchlaufzeiten, geringere Fehlerquoten, höhere Kundenzufriedenheit oder zusätzlichen Umsatz pro Kunde betrachten. Zusätzlich steigt die Employee-Experience und damit die Attraktivität der Arbeitgeber. Diese Faktoren sind aus meiner Sicht aussagekräftiger als kurzfristige Rentabilitätsrechnungen. Copilot und generative KI sind strategische Investitionen in die Zukunftsfähigkeit der Organisation.
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit KI in der Fläche wirksam wird?
Der erste Nutzen von KI entsteht häufig im Alltag: Routinetätigkeiten lassen sich schneller erledigen, Informationen sind leichter zugänglich und Mitarbeitende können produktiver und kreativer arbeiten.
Damit sich dieser Effekt nicht auf einzelne Projekte beschränkt, sondern in der Breite trägt, braucht es drei zentrale Rahmenbedingungen. Erstens eine AI-Ready Organization mit klaren Entscheidungswegen und Verantwortlichkeiten. Strukturen wie ein Center of Excellence bündeln Wissen, machen Erfahrungen unternehmensweit nutzbar und sorgen für kurze Entscheidungen. Zweitens AI-Ready Tools – eine technische Basis, die auf konsistenter Dokumentenklassifizierung und einem durchgängigen Berechtigungsmanagement aufbaut. Drittens AI-Ready People: Transformation beginnt beim Mindset. Mitarbeitende müssen befähigt werden, sich bei jeder Aufgabe zu fragen, wie KI sie konkret unterstützen kann und welchen Mehrwert sie dadurch schaffen.
Wie geht es weiter, wenn diese Grundlagen geschaffen sind?
Dann folgt der nächste Schritt: die Optimierung von Business-Prozessen, sowohl intern als auch dort, wo die eigentliche Wertschöpfung entsteht. Vom individuellen Produktivitätsschub geht es zur zweiten Stufe, in der der Mehrwert deutlich sichtbarer und auch berechenbarer wird. Ein typisches Beispiel ist HR. Viele Anfragen betreffen Informationen, die in Richtlinien oder Dokumenten bereits vorliegen. Ein HR-Agent kann solche Fragen direkt beantworten, die Zahl der Tickets sinkt und HR gewinnt Zeit für strategische Aufgaben. Durch die Anbindung bestehender Systeme lassen sich Anfragen nicht nur beantworten, sondern auch direkt umsetzen – etwa bei der Urlaubsplanung oder der Änderung persönlicher Daten.
Ähnliche Effekte sehen wir beim Onboarding neuer Mitarbeitenden. In den ersten Wochen tauchen viele Fragen auf, die sich mit intelligenten Assistenten sofort klären lassen oder gezielt an die richtigen Ansprechpersonen weitergeleitet werden. Das erleichtert den Einstieg und verkürzt die Einarbeitungszeit.
Auch der Rechtsbereich profitiert. Bei der Prüfung umfangreicher Dokumente können Agenten relevante Inhalte wie Garantiepflichten oder Fristen automatisch identifizieren. Risiken sinken, Abläufe beschleunigen sich. Gerade im Rechtsbereich zeigt sich zudem, dass durch den Einsatz von Agenten externe Kosten, etwa für Rechtsberatung, spürbar reduziert werden können.
Neben diesen universellen Szenarien entstehen zunehmend branchenspezifische Anwendungen, die direkt an wertschöpfende Prozesse andocken. Entscheidend ist, Systeme sinnvoll zu verknüpfen und Agenten orchestriert einzusetzen.
Ihr Unternehmen hat bereits mehr als 400 Copilot-Projekte begleitet. Welche Stolpersteine treten nach dem Start bei der Einführung und Nutzung von Copilot und generativer KI am häufigsten auf?
Ein häufiger Stolperstein ist die Erwartungshaltung. Copilot ist ein starkes Werkzeug, aber kein Allheilmittel. Wenn ohne klare Zielarchitektur gestartet oder organisatorische Defizite ausgeblendet werden, entsteht schnell Ernüchterung.
Darüber hinaus erleben wir, dass das hohe Tempo zur Herausforderung wird. Allein 2024 gab es über 700 Updates und 150 neue Funktionen bei M365 Copilot.
Unternehmen müssen diese Dynamik kanalisieren und ihre Mitarbeitenden Schritt für Schritt mitnehmen. Warten, bis die Technologie «fertig» ist, ist keine Option – wer zögert, verliert schnell den Anschluss. Gefragt ist vielmehr Agilität: Statt starren Planungen braucht es flexible Strukturen, die Anpassungen zulassen und kontinuierliches Lernen ermöglichen.
Wie gelingt es, Mitarbeitende auf dieser Reise mitzunehmen und mögliche Ängste in Motivation zu verwandeln?
Der Schlüssel liegt in einem klaren «Why». Organisationen, die KI nur einführen, weil es alle tun, stossen schnell an Grenzen. Erfolgreich sind diejenigen, die von Beginn an definieren, warum sie starten und welches Ergebnis sie erreichen wollen. Das schafft Orientierung für Management, Projektteams und die gesamte Belegschaft.
Ebenso wichtig ist Transparenz. Risiken und Unsicherheiten sollten offen angesprochen werden, gleichzeitig machen konkrete Beispiele aus dem Arbeitsalltag den Nutzen unmittelbar erfahrbar.
Und schliesslich braucht es Zeit. Transformation gelingt nicht nebenbei. Mitarbeitende müssen die Möglichkeit haben, Erfahrungen zu sammeln. Oft reicht schon der erste Aha-Moment, um Begeisterung zu wecken. Unsere Aufgabe ist es, genau solche Erlebnisse zu ermöglichen und praxisnahe Use-Cases bereitzustellen, die inspirieren und direkt weiterhelfen.
Wenn KI zum festen Bestandteil des Arbeitsalltags wird, wie verändert sich die Rolle des Menschen?
Ich sehe den Menschen klar in der Rolle des aktiven Gestalters. Technologie lässt sich nicht aufhalten, sie lässt sich nur mitgestalten. Wer diese Chance nicht nutzt, verliert an Relevanz.
Mit dem Einzug von KI verschieben sich Aufgabenfelder: Routinetätigkeiten können stärker von Systemen übernommen werden, während für die Mitarbeitenden komplexere, kreative und strategische Aufgaben in den Vordergrund rücken. Das erfordert neue Fähigkeiten und eine Kultur, die den bewussten Umgang mit KI fördert.
Wichtig ist, die sozialen Aspekte nicht auszublenden. Es geht darum, Kompetenzen aufzubauen, Vertrauen zu schaffen und die Menschen in die Lage zu versetzen, den Wandel aktiv zu begleiten. Ängste und Unsicherheiten gehören zu jeder technologischen Transformation, vergleichbar mit historischen Umbrüchen wie Elektrizität oder dem Internet. Auch damals gab es Verunsicherung – heute können wir uns ein Leben ohne nicht mehr vorstellen.
Neben der Rolle des Menschen rückt auch die Rolle intelligenter Agenten in den Fokus. Aktuell wird viel über KI-Agenten diskutiert. Welche Bedeutung werden sie in den kommenden Jahren in Unternehmen haben?
KI-Agenten sind die nächste Evolutionsstufe. Heute sehen wir erste Szenarien, in denen Agenten Informationen beschaffen oder einfache Aufgaben übernehmen. Der wirkliche Durchbruch kommt dann, wenn spezialisierte Agenten in Drittsysteme schreiben und komplexe Prozesse abwickeln können – immer orchestriert durch einen Process-Owner und abgesichert durch den Human in the loop. Damit ist gemeint, dass der Mensch weiterhin an entscheidenden Punkten eingreift, kontrolliert und korrigiert, um die Qualität und Verlässlichkeit der Ergebnisse sicherzustellen. Mittelfristig kann ich mir vorstellen, dass die Agenten auch autonomer agieren können und werden.
Damit entsteht eine ganz neue Form der Zusammenarbeit zwischen Mensch und KI. Unternehmen, die frühzeitig Erfahrungen sammeln, verschaffen sich einen klaren Wettbewerbsvorteil. Denn hier geht es nicht mehr um einzelne Tools, sondern um den Aufbau einer zentralen AI-Plattform, die Prozesse, Systeme und Menschen intelligent verbindet. Wer diese Entwicklung aktiv mitgestaltet, legt heute den Grundstein für die Wettbewerbsfähigkeit von morgen.
Weitere Informationen unter campana-schott.com

Zur Person
Pascal Brunner-Nikolla ist Senior Manager und Head of Modern Work Switzerland bei der Management- und Technologieberatung Campana & Schott. Darüber hinaus ist er Microsoft MVP im Bereich M365 Copilot und Copilot Agents. Als LinkedIn Top Voice erreicht er jährlich über vier Millionen Menschen und teilt regelmässig Einblicke rund um Copilot in Organisationen. Sein Newsletter «Copilot Your Day» erscheint wöchentlich am Montagmorgen und gibt praxisnahe Impulse für den erfolgreichen Einsatz von KI im Arbeitsalltag.


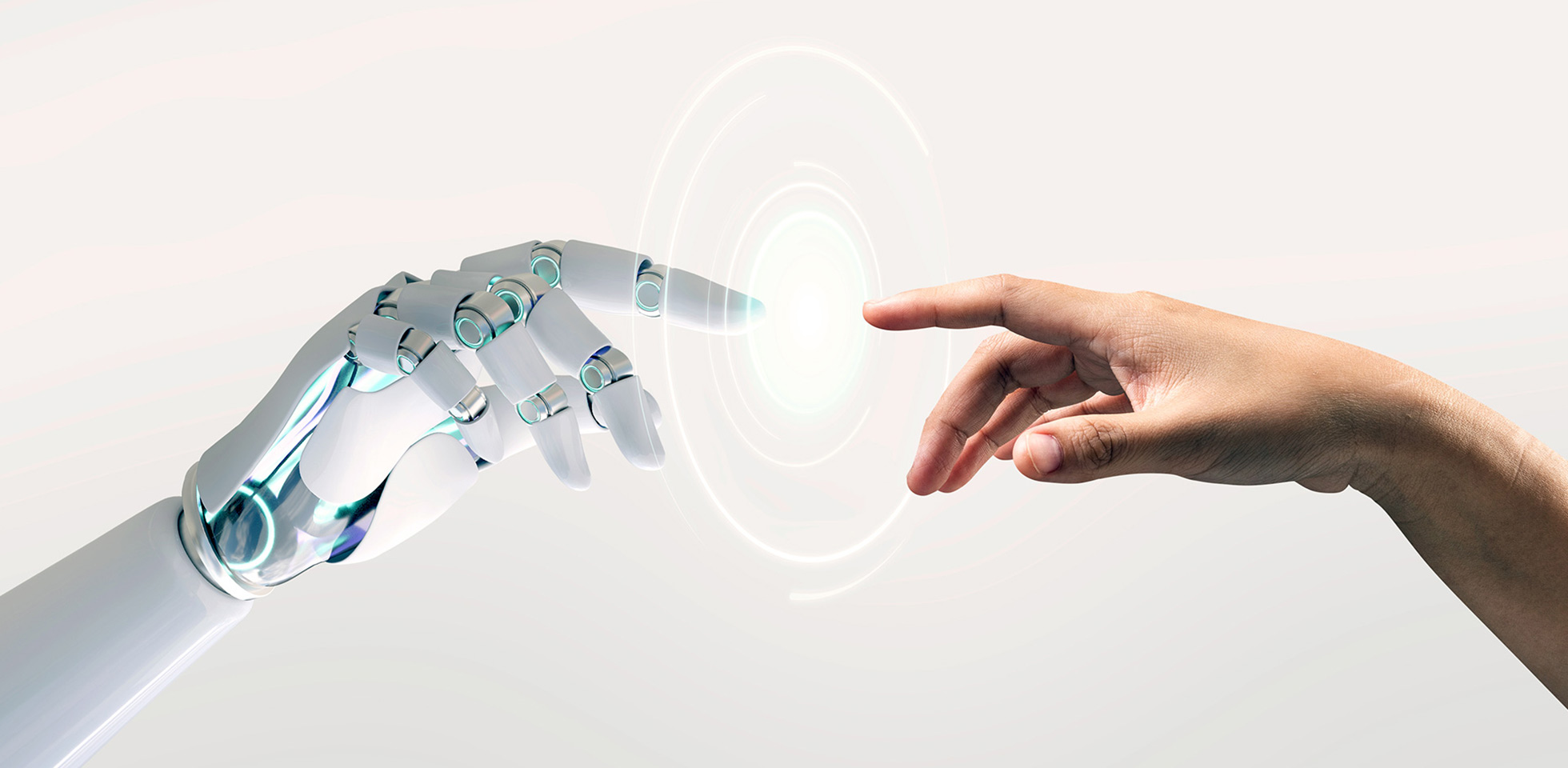
Schreibe einen Kommentar