Deutschland diskutiert gerne über Digitalisierung, künstliche Intelligenz (KI) und industrielle Transformation – nur bei der Umsetzung bleiben wir oft im Konjunktiv und lassen gute Ideen und Potenziale ungenutzt. So wurden führende Köpfe in der KI-Revolution bekanntermaßen an deutschen Universitäten ausgebildet, arbeiten nun aber in den USA. Es wird Zeit, den Blick stärker auf die Praxis zu richten: dorthin, wo Zukunft tatsächlich entsteht – in der Verbindung von Technologie, Industrie und realen Anwendungen und die nächsten technologischen Revolutionen nicht leichtfertig aus der Hand zu geben.
Wenn sich agentische KI mit Robotik vereint
Eine solche Revolution könnte die autonome, intelligente Robotik sein. Die neue Generation von KI ist nicht nur reaktiv, sondern handlungsfähig. »Agentische KI« wird zunehmend in der Lage sein, eigenständig Aufgaben zu planen und auszuführen. Anders als heutige Systeme wird sie jedoch auch einen physischen Körper haben – und damit die Fähigkeit, mit der realen Welt zu interagieren. Die größte Herausforderung dabei ist die reale Welt selbst: Maschinen müssen ihre Umgebung erfassen, verstehen und vorausschauend handeln können. Sie müssen antizipieren, wie die wirkliche Welt auf ihr Tun reagiert und welche Folgen daraus entstehen.
Ohne robuste Sensorik und einen physischen Körper bleibt KI jedoch blind und handlungsunfähig. Ebenso entscheidend ist, dass die Rechen- und Steuerintelligenz der KI direkt im Roboter integriert ist, um die nötige Reaktionsgeschwindigkeit und Sicherheit zu gewährleisten. Daher widmet sich die Wissenschaft gerade der Verknüpfung all dieser Technologien: Große KI-Modelle, die ihre Umgebung über Sensordaten erfassen, diese analysieren, schlussfolgern, was zu tun ist, und dies schließlich in konkretes Handeln übersetzen. Viele Grundlagen sind bereits gelegt. Damit entsteht ein entscheidender Schritt hin zu Maschinen, die in Echtzeit mit ihrer Umwelt interagieren.
Industrie neu denken – von Automatisierung zur AI-Assisted Factory
Diese Entwicklung ermöglicht völlig neue Möglichkeiten der Interaktion mit Technologie. Insbesondere im Mittelstand, aber ebenso in großen Betrieben lassen sich einzelne oder mehrere Produktionsschritte einfach und kostengünstig automatisieren. Die bislang aufwendige und teure Spezialprogrammierung von Robotern und Maschinen kann wesentlich vereinfacht werden oder ganz durch eine umgangssprachliche Interaktion ersetzt werden. So entstehen Lösungen, die Prozesse effizienter machen, Ausschuss reduzieren und Raum für neue Geschäftsmodelle eröffnen. Für Deutschland ist das mehr als ein Produktivitätsschub, es stärkt die wirtschaftliche Souveränität, da Automatisierung auch für kleine und mittelständische Betriebe erschwinglich und damit flächendeckend sinnvoll wird.
Der nächste Schritt heißt AI-Assisted Factory: Produktionsprozesse, Maschinensteuerung und Betriebsführung werden durch vernetzte KI-Systeme definiert und damit flexibel wie Baukastensysteme gestaltet. Einzelne Funktionen lassen sich dynamisch anpassen – von der Intralogistik bis zur Maschinenwartung. So kann eine Fabrik kurzfristig auf Marktbedarfe reagieren, zwischen Produktlinien wechseln oder Kapazitäten neu verteilen. Industrie 4.0 hat die Grundlagen gelegt, Industrie 5.0 ist nun in der Umsetzung – nicht als Vision, sondern bereits als gelebte Realität in ersten Produktionsumgebungen.
KI als Kollege
Künstliche Intelligenz wird zunehmend in Organisationen eingebettet. Nicht als Ersatz, sondern als Ergänzung. In Logistik, Verwaltung oder Planung übernehmen KI-Systeme Routineaufgaben, analysieren Daten und schlagen Optionen vor. Menschen behalten den Überblick, setzen Prioritäten und tragen Verantwortung. Damit verändert sich die Arbeitsteilung grundlegend: KI wird zum »digitalen Kollegen«, der unermüdlich rechnet, sortiert und organisiert. Der Mehrwert liegt darin, dass Mitarbeitende sich auf strategische, kreative und kundennahe Aufgaben konzentrieren können.
Vertrauenswürdigkeit und Regulierung: Hemmschuh oder Chance
Europa diskutiert über Regulierung von Entwicklungen im Bereich der KI oft länger, als die Konkurrenz in den USA oder Asien für deren Umsetzung braucht. Doch klug gemachte Regeln sind kein Innovationshemmnis. Richtig ausgestaltet können sie sogar zum Standortvorteil werden: Qualität, Sicherheit und Vertrauen sind echte Wettbewerbsvorteile. Gleichzeitig zeigen aktuelle Umfragen: KI wird von vielen genutzt, doch das Vertrauen bleibt gering. Deshalb ist es essenziell, dass die Wissenschaft Methoden entwickelt, um die KI vertrauenswürdiger, verständlicher und robuster zu machen. Insbesondere dann, wenn KI mit der echten Welt interagiert. Auch wenn diese Probleme noch nicht gelöst sind, so sind die Fortschritte sichtbar. Es wäre also fatal, wenn übertriebene Angst zu einer Skepsis an der Technologie an sich führen würde und die weitere Entwicklung durch gut gemeinte, aber schlecht umgesetzte Regulierung unterbunden oder ausgebremst wird. Entscheidend ist, Risiken beherrschbar zu machen und einen Regulierungsrahmen zu schaffen, der Freiräume für Innovation eröffnet.
Fazit: Deutschland braucht Mut zur Umsetzung
Deutschland erlebt einen tiefgreifenden Strukturwandel: Klassische Industriearbeitsplätze gehen zurück, während Pflege, Gesundheit und soziale Dienstleistungen wachsen. Die Industrie bleibt wichtig, doch Wohlstand wird in Zukunft auch stärker durch digitale Geschäftsmodelle, KI und innovative Produktionskonzepte gesichert Das ist keine Absage an die Industrie, sondern die Weiterentwicklung ihres Erfolgsmodells. Dafür braucht es keine weiteren Gipfeltreffen, sondern entschlossenes Handeln: Fördermittel müssen zielgerichtet in Umsetzung fließen, Regularien praxisnah gestaltet und Pilotprojekte schneller skaliert werden.
Die Bausteine sind vorhanden: eingebettete KI, flexible Produktionskonzepte, smarte Sensorik und Aktuatorik. Jetzt braucht es die Bereitschaft, sie konsequent einzusetzen. Weniger Ankündigungen, mehr Taten. Oder anders gesagt: weniger Gipfel, mehr Innovation.
Text Wolfgang Gröting, Head of Innovation Center and Sales und Prof. Dr. Hendrik Wöhrle, Leitung Smart Embedded Systems am Fraunhofer IMS


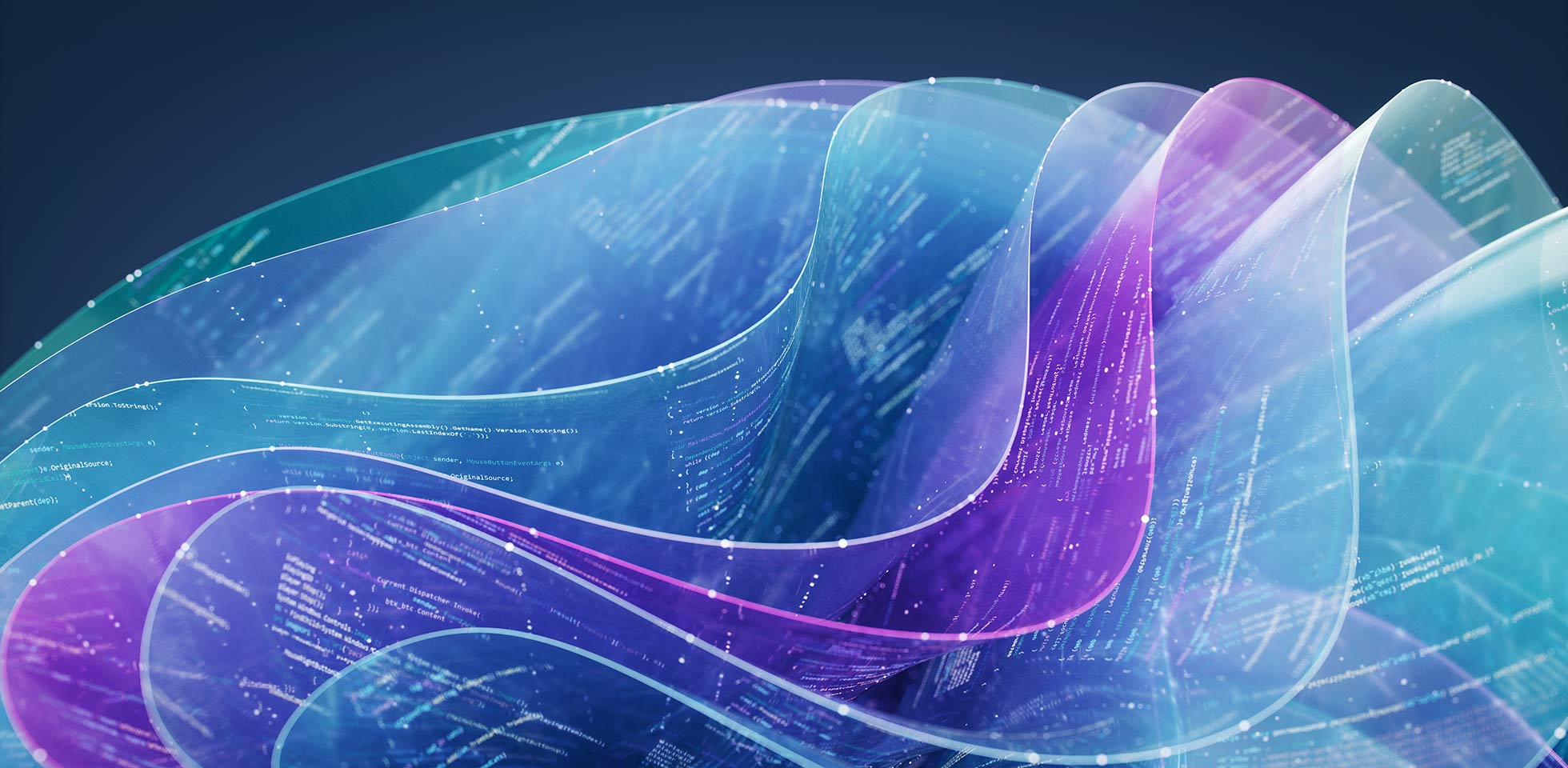
Schreibe einen Kommentar