Die wichtigsten Kriterien für die Planung und den Betrieb einer Ladeinfrastruktur
Das Laden der E-Fahrzeuge zu Hause spielt in Zukunft eine zentrale Rolle für die Durchsetzung und Akzeptanz der Elektromobilität. Ein Schlüsselproblem ist das Lastmanagement, um einen stabilen Betrieb des Stromnetzes zu gewährleisten.
Um die energie- und klimapolitischen Ziele des Bundes zu erreichen, sollen mittelfristig auch Elektrofahrzeuge einen wesentlichen Beitrag dazu leisten. Die Schweiz investiert stark in erneuerbare Energien; der Ausbau von Wasser-, Wind- und Solarenergie sowie die Verbesserung der Energiespeichertechnologien könnten dazu beitragen, den steigenden Bedarf an Strom auch für Elektroautos zu decken. Doch reicht der Strom tatsächlich dafür, auch wenn die Schweizerinnen und Schweizer dieser Empfehlung folgen und alle auf ein E-Auto umsteigen würden? Und wenn in der Tiefgarage einer Grossüberbauung mit mehreren Mehrfamilienhäusern über Nacht gleichzeitig die Batterien von 200 Fahrzeugen aufgeladen werden müssten?
Lastmanagement gleicht aus
Gemäss Fachleuten ist dafür die Netzkapazität die grosse Herausforderung. Die teilweise vor Jahren in Betrieb genommenen Niederspannungsnetze auf regionaler und lokaler Ebene sind nicht darauf ausgelegt, eine grössere Anzahl von E-Autos gleichzeitig zu laden – ein Zusammenbruch des Stromnetzes wäre die unmittelbare Folge. Verhindert wird dieses Szenario durch sogenannte Lastmanagement-Systeme, die das Aufladen der E-Fahrzeuge koordinieren. Sie messen, wie viel Strom zeitnah produziert und zugeführt und wie viel in den Haushalten der Überbauung gerade verbraucht wird. Abends, wenn die Bewohner und Bewohnerinnen zu Hause sind und Haushaltsgeräte im Einsatz haben, wird das Aufladen der Batterien gedrosselt oder unterbrochen. In den Nachtstunden, meistens ab Mitternacht, kann dann wieder vermehrt Strom in die Ladestationen geleitet werden. Auf diese Weise stellt das Lastmanagementsystem sicher, dass die Ladestation effizient genutzt wird, ohne das Stromnetz zu überlasten und sorgt so für eine stabilere Stromversorgung für alle. Bei 200 Fahrzeugen in einer Tiefgarage ist es allerdings nicht sicher, ob diese für alle Fahrzeuge reicht. In der Realität ist der Anteil von Elektrofahrzeugen mit rund 18 Prozent Ende 2022 noch überschaubar und sogar leicht stockend, sodass es in naher Zukunft noch nicht zu dieser Aufgabenstellung kommen wird.
Normale Steckdosen ungeeignet
Wer ein E-Fahrzeug privat anschafft und davon ausgeht, dass er es einfach an der Steckdose in der Garage seines Einfamilienhauses aufladen kann, geht von einer falschen Annahme aus. Normale Haushaltssteckdosen sind ungeeignet, weil sie nicht für eine so hohe Dauerlast ausgelegt sind. Es muss also zwingend eine entsprechende Ladestation eingerichtet werden. Für private Einzellösungen werden meist Wechselstrom-Ladestationen (AC) bis 22 kW Ladeleistung verwendet, da man ja in der Regel genug Zeit hat zum Laden und vor allem über Nacht. Gleichstrom-Ladestationen (DC) werden vor allem im öffentlichen Raum oder an Autobahnen eingesetzt. Mit einer Ladeleistung von bis zu 350 kW ermöglichen sie das sogenannte «High Charging». Energie für 100 Kilometer kann an solchen Stationen teilweise in unter 20 Minuten geladen werden.
Ladestationen für Mieter:innen
Das Einrichten von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in Wohnüberbauungen mit vorwiegend Mietwohnungen erfordert eine sorgfältige Planung und Koordination, die am besten von der Liegenschaftsverwaltung durchgeführt wird. Eine Bedarfsanalyse zeigt auf, wie viele Mieter und Mieterinnen bereits ein Elektrofahrzeug besitzen oder in Zukunft wahrscheinlich kaufen werden. Danach ist es wichtig, die geeignete Technologie für die Ladestationen auszuwählen und sicherzustellen, dass die Infrastruktur des Gebäudes die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Bei dieser Gelegenheit kann auch die Energieversorgung überprüft werden, ob für die Ladestationen ganz oder teilweise nachhaltig erzeugter Strom bezogen werden könnte.
Die Kommunikation mit den Mieterinnen und Mietern ist ein weiterer wichtiger Aspekt. Eine transparente Information über die Installation der Ladestationen, die Nutzungsbedingungen, die Abrechnungsmethoden und mögliche Kosten ist wichtig, um das Verständnis und die Akzeptanz der Mieter:innen zu fördern. Idealerweise sollte die Liegenschaftsverwaltung auch einen Kundensupport für technische Fragen oder Probleme mit den Ladestationen anbieten, um eine reibungslose Einführung sicherzustellen. Die Auswahl eines zuverlässigen Anbieters ist wichtig, die nach den Kriterien Kosten, Ladeleistung, Benutzerfreundlichkeit und Kundenservice ausgewählt werden kann.
Lösungen für Stockwerkeigentümer:innen
Auch Stockwerkeigentümer:innen sind nicht ganz frei in ihren Entscheidungen und können nicht einfach mal auf dem Parkplatz auf eigene Faust eine Ladestation einrichten. Der Weg führt also über die Eigentümerversammlung, die letztendlich das Projekt mit dem entsprechenden Budget bewilligen muss. Gerade die Frage der Kostenverteilung ist oft ein sensibles Thema. Es ist zudem zu klären, ob die Eigentümerschaft die Gesamthoheit über die Installation oder nur über die Grundinstallation behält. Es empfiehlt sich, klare Richtlinien und Regelungen für die Nutzung der Ladestationen festzulegen, in der Nutzungszeiten, die Abrechnung der Kosten und die Verantwortlichkeiten für Wartung und Reparaturen festgehalten sind. Ein Tipp der Expert:innen: Die transparente Vorbereitung mithilfe einer Fachperson erhöht die Erfolgschancen erheblich.


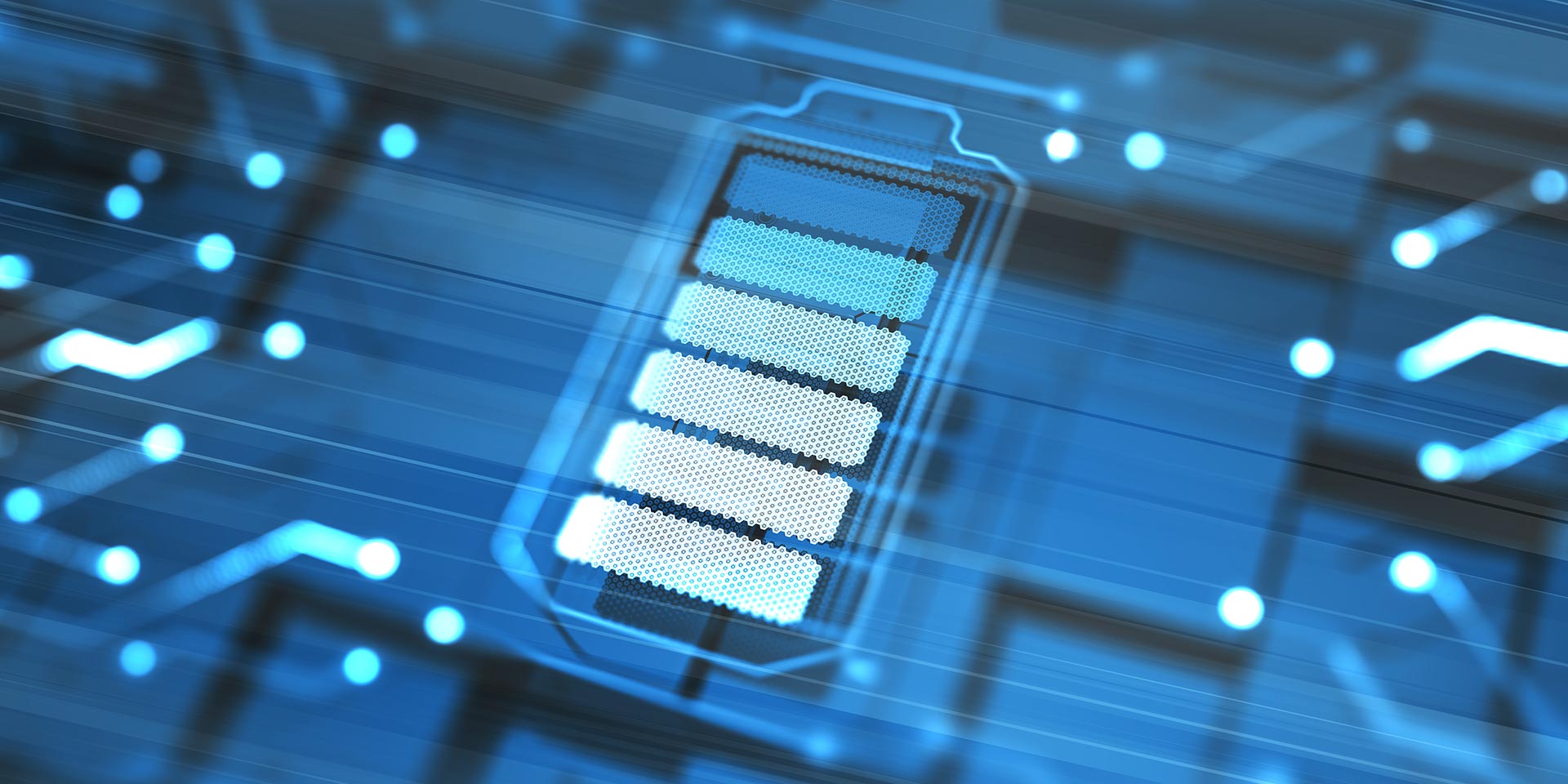
Schreibe einen Kommentar