Alle Menschen wollen sicherstellen, dass die Ansprüche ihrer Nachkommen gewahrt werden. Dafür bildet das Erbrecht in der Schweiz die juristische Grundlage, denn es regelt den Übergang von Vermögen und Besitz nach dem Tod einer Person. Anbei erläutert «Fokus» die Grundlagen des Erbrechts.
Das Schweizer Erbrecht basiert auf dem Zivilgesetzbuch (ZGB) und hat eine lange Tradition. Es räumt jeder Person die grundsätzliche Freiheit ein, über ihr Vermögen und ihren Besitz zu Lebzeiten sowie nach ihrem Tod zu verfügen. Dabei kann das Vermögen an Erbinnen und Erben vererbt oder durch ein Testament oder einen Erbvertrag geregelt werden. Das Erbrecht organisiert dabei nicht nur die Verteilung von allfälligen Geldwerten und Eigentum, sondern legt je nachdem auch die Rechte und Pflichten fest, die mit einem Erbe einhergehen.
Im schweizerischen Erbrecht werden grundsätzlich zwei Arten der Erbfolge unterschieden: die gesetzliche sowie die testamentarische Erbfolge. Die gesetzliche Erbfolge tritt jeweils dann in Kraft, wenn keine letztwillige Verfügung vorliegt, sprich, wenn zu Lebzeiten kein Testament oder Erbvertrag erstellt wurden. In diesem Fall richtet sich die Verteilung des Erbes nach den gesetzlichen Bestimmungen. Wie Fachleute und Branchenkenner:innen allerdings betonen, entspricht die gesetzliche Erbfolge relativ häufig nicht den Vorstellungen oder Vorlieben der Erblasser:innen. So werden im Erbrecht zum Beispiel gewisse Personen nicht berücksichtigt, darunter die Konkubinatspartner:innen. Und auch überlebende Ehepartner:innen können etwa dann in finanzielle Bedrängnis geraten, wenn zum Beispiel die Kinder ausbezahlt werden müssen. Dies kann vor allem dann eintreffen, wenn ein Grossteil des Vermögens in Form eines Eigenheims gebunden ist.
Erbrecht den neuen Gegebenheiten angepasst
Wer genauer definieren möchte, wie das eigene Vermögen nach dem Ableben verteilt wird, sollte daher ein Testament verfassen. Darin lässt sich zum Beispiel festlegen, dass ein gesetzlicher Erbe eine höhere oder eine niedrigere Quote am Nachlass erhalten soll, als es die gesetzliche Erbfolge vorsieht. Gleichzeitig kann auch anderen Personen ein Anteil am Erbe zugewiesen werden, wie etwa einer Konkubinatspartnerin oder einem Konkubinatspartner. Allerdings: Vollkommen freie Hand geniesst man auch mit einem Testament nicht, denn das Erbrecht schreibt vor, dass bestimmte Personen einen Mindestanteil am Erbe erhalten. Hierbei handelt es sich um den sogenannten Pflichtteil. Und in diesem Bereich ergeben sich per diesem Jahr gewisse Änderungen. Diese Anpassungen wurden vom Bund eingeleitet, um das Erbrecht den modernen gesellschaftliche und familiären Strukturen anzupassen.
Wer genauer definieren möchte, wie das eigene Vermögen nach dem Ableben verteilt wird, sollte daher ein Testament verfassen.
Welche Neuerungen ergeben sich also konkret? Liegt kein Testament vor, ändert sich im Grundsatz nichts, der Nachlass wird weiterhin nach der gesetzlichen Erbfolge verteilt. Wenn zum Beispiel eine verstorbene Person verheiratet war und nebst einer Partnerin oder einem Partner auch Kinder hinterlässt, wird die Hälfte des güterrechtlichen Anspruchs an den überlebenden Teil des Ehepaars und die andere Hälfte an die Kinder verteilt. So weit, so unverändert. Liegt hingegen ein Testament vor, ist im revidierten Erbrecht von 2023 eine Anpassung des Pflichtteils vorgesehen. Neu beläuft sich dieser für direkte Nachkommen nur noch auf 50 statt 75 Prozent, der Pflichtteil für die Eltern einer verstorbenen Person entfällt sogar ganz. Das hat zur Folge, dass Erblasser mehr Flexibilität geniessen, wenn es darum geht, ihr Vermögen nach ihren Wünschen zu vererben. Diese sogenannte «frei verfügbare Quote» beträgt durch die Verringerung des Pflichtteils neu 50 Prozent und kann zum Beispiel auch an Organisationen vererbt werden.
Wie man ein Testament richtig verfasst
Anbei folgt eine Anleitung für das Verfassen eines Testaments, basierend auf den Empfehlungen des Bundes.
Das handschriftliche – oder auch eigenhändige – Testament ist die einfachste Art, das eigene Erbe selbst zu regeln, denn dafür wird keine Notarin und kein Notar benötigt.
Ein handgeschriebenes Testament muss folgende Elemente enthalten:
• Die Überschrift «Testament»
• Vorname, Familiennname, Geburtsdatum und allenfalls den Heimatsort
• Den letzten Willen der Verfasserin / des Verfassers
• Falls ein Testamentsvollstrecker gewünscht wird: den Namen der Person, die sich um die Verteilung des Erbes kümmern und das Testament vollstrecken wird. Dies kann eine Person des Vertrauens sein (Erbin, Erbe oder eine andere Person) oder aber eine Rechtsanwältin, ein Rechtsanwalt, eine Notarin oder ein Notar. Auch eine Bank oder eine Treuhandgesellschaft kann hier zum Zuge kommen. Es kann hilfreich sein, eine Person für die Testamentsvollstreckung im Voraus zu bestimmen, denn dies erleichtert die Teilung des Erbes und hilft, Erbstreitigkeiten zu vermeiden.
• Ort und Datum
• Unterschrift der Verfasserin / des Verfassers am Ende des Testaments
Ändern eines Testaments
Ein Testament lässt sich jederzeit abändern. Eine Änderung muss immer handschriftlich erfolgen und mit der Unterschrift und dem Datum versehen werden. Man kann ein Testament auch widerrufen, indem man es vernichtet oder es gegen ein anderes ersetzt. Damit es nicht zu Missverständnissen kommt, ist zu empfehlen, im neuen Testament explizit zu schreiben, dass das alte Testament widerrufen wird.


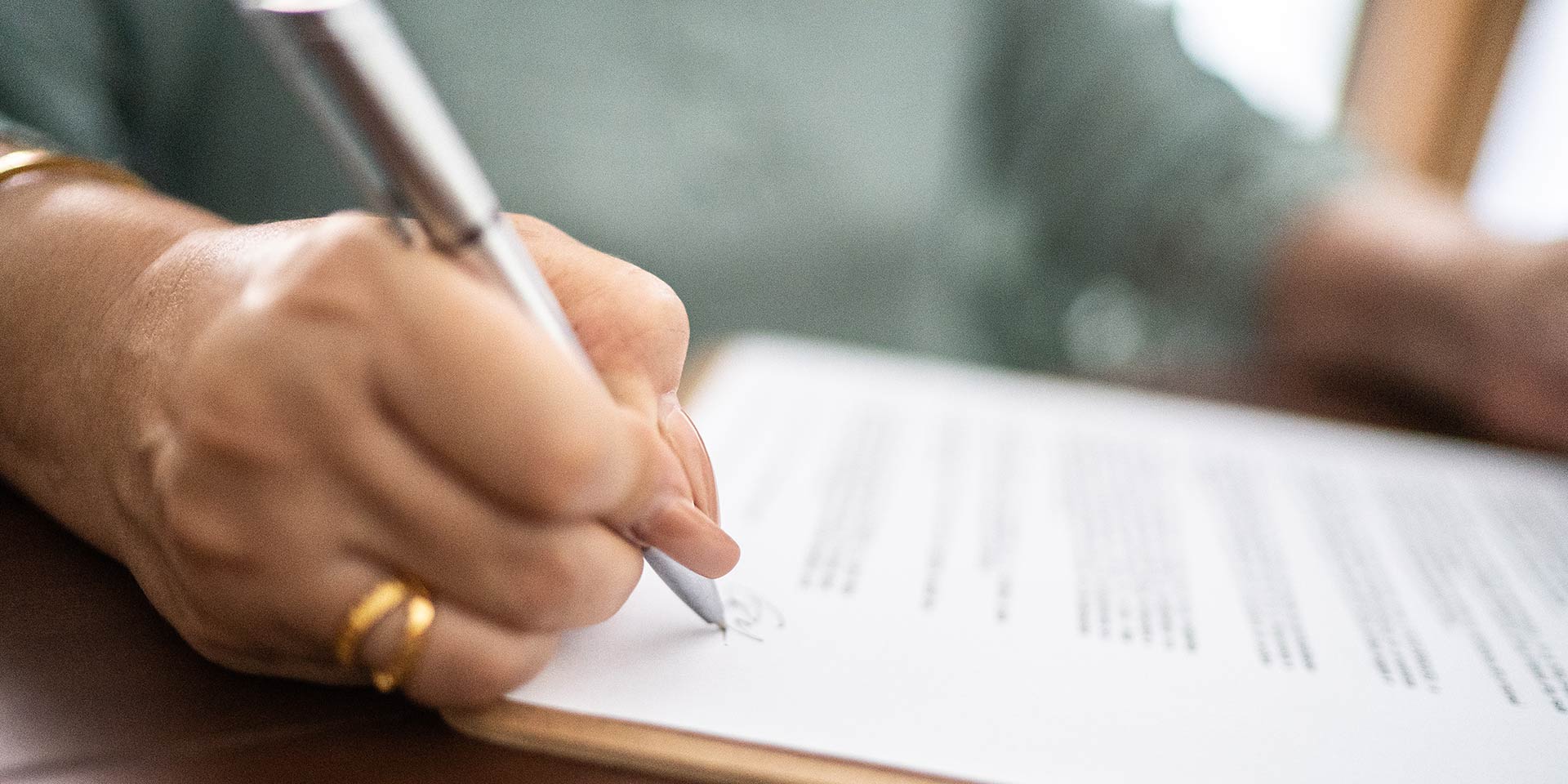
Schreibe einen Kommentar