Die Diagnose Krebs kommt oft unerwartet. Eine seltene Krebsart ist der Morbus Hodgkin (Lymphdrüsenkrebs). Weniger als ein Prozent der Schweizer Bevölkerung erkrankt an dieser Krebsart. Die heute 26-jährige Christine ist eine davon.
Lymphdrüsenkrebs gehört zur Gruppe der bösartigen Lymphome. Der bösartige Tumor entsteht aus Zellen des lymphatischen Gewebes. Da das lymphatische System Teil des Immunsystems ist, liegt das Risiko an dieser Art von Krebs zu erkranken, bei einer Autoimmunerkrankung höher. So z.B. bei Multipler Sklerose oder, wie bei Christine, Lupus erythermatodes.
Der erste Hinweis
Die ersten Anzeichen kamen völlig unerwartet. Christine verspürte mitten in der Nacht einen heftig stechenden Schmerz am linken Hüftknochen. «Es fühlte sich an, als würde mir jemand ein Messer in diesen Knochen stechen. Der Schmerz war so intensiv, er riss mich aus dem Schlaf», erzählte sie mit grossen Augen. Sie spürte, dass man dies nicht ignorieren sollte und suchte einige Tage später einen Arzt auf. Doch die Ärzte schickten sie von einem Spezialisten zum anderen. Keiner konnte der damals 22-jährigen jungen Frau Auskunft darüber geben, was dieser Schmerz zu bedeuten hat. Sie führten dieses Symptom auf ihre Krankheit Lupus erythematodes zurück und der anhaltende Schmerz wurde lediglich mit Schmerzmitteln unterdrückt. Bis nach etlichen Untersuchen bei Christine das Telefon klingelte und ein Termin beim Hausarzt anstand. Die Endbefunde der Untersuchungen müssen besprochen werden.
Der anhaltende Schmerz wurde lediglich mit Schmerzmitteln unterdrückt.
«Es war zwei Minuten vor zwölf»
Der zuständige Arzt klärte sie und ihren Freund über den Krebsbefund des Hodgkin Lymphoms, Lymphdrüsenkrebs, im vierten Stadium auf. Er vermutete, dass der Krebs schon länger ausgebrochen war. Er erklärte, dass die Heilungschancen bei dieser Krebsart jedoch erfahrungsgemäss hoch seien. Ausser dem Lupus und einem früheren Hautausschlag an der Stirn nach Alkoholkonsum gab es keine auffallenden Anzeichen. «Es war ein Schock. An den darauffolgenden Tagen weinte ich viel. Jedoch hatte ich keine Sekunde Angst, dass ich sterben werde», äussert sich Christine selbstbewusst. Als sie diese Nachricht verdaut hatte, fragte sich Christine, wie sie ihrem Umfeld die Botschaft überbringe solle. Dies war eine der schwierigsten Herausforderungen für sie. Bei der Übermittlung der schlechten Nachricht wurde sie immer wieder aufs Neue an die bevorstehende Chemotherapie erinnert.
Unterschiedliche Verarbeitung
Als Angehörige ist diese Nachricht, dass jemand an Krebs erkrankt ist und dass eine Chemotherapie ansteht, oft überfordernd und traurig zugleich. «Es gab verschiedenste Reaktionen, wobei bei allen Angehörigen Tränen geflossen sind. Meine Mutter traf es sehr hart. Ich nahm sie in den Arm und versuchte sie zu trösten. Daraufhin entgegnete sie mir, ich solle niemanden trösten, sie müsse mich trösten!», erklärt Christine mit einem Lächeln.
Der Vater von ihr verarbeitete den Schock auf seine Art. Er holte den Schnaps aus dem Regal und schenkte allen ein Gläschen ein. Doch welche Reaktion war für Christine am angenehmsten? Christine: «Es gab mir ein gestärktes Gefühl, wenn mir das Gegenüber ehrliche Anteilnahme und positive Energie schenkte. Wenn es mir anbot, mich bei einem Arzttermin zu begleiten oder mich besuchen zu kommen. In solchen Zeiten bemerkt man, wer wirklich für einen da ist. Ich mag es nicht, wenn mich jemand mit Samthandschuhen anfassen will», und fügt lachend hinzu: «Mein Freund schaffte es jedoch immer, mich zum Lachen zu bringen. Als ich keine Haare mehr hatte, schlug er vor, mir einen blauen Pfeil auf die Stirn zu malen und spielte damit auf den bekannten Film Avatar an.»
Der Arzt empfahl mir, während der Chemotherapie, auf meine Lieblingsgerichte zu verzichten.
Verändertes Geschmacksempfinden
Christine, mit ihren langen braunen Haaren und langen Wimpern, entschied sich für die starke Chemotherapie. Die Therapie umfasste 18 Wochen, welche aus sechs Zyklen bestand. Die erste Woche des Zyklus beinhaltete drei ambulante Tage, im Unispital Zürich für die Infusionen und parallele Behandlung von Medikamenten in Tablettenform. Die zweite Woche wurde mit anderen Medikamenten weitergeführt und die letzte Woche, diente zur Erholung.
Ihre Mutter begleitete sie zur ersten Chemotherapie. Mit ihren 22 Jahren war sie die Jüngste im Warteraum und sehr nervös. «Ich erinnere mich, dass mir meine Mutter während der Infusion ein Käse-Sandwich brachte. Darin war eine eingelegte Paprika. Ich musste mich fast übergeben. Der Arzt empfahl mir, während der Chemotherapie, auf meine Lieblingsgerichte zu verzichten, da sich das Geschmacksempfinden stark verändert. Diese Wahrnehmungen können sich so stark einprägen, dass sie auch nach der Therapie noch bestehen», erzählt Christine. Sie fügt hinzu, dass sie bis heute keine eingelegten Paprika mehr essen könne.
Individuelle Therapie
Das Schlimmste für die positiv eingestellte Frau waren die darauffolgende Übelkeit und das pausenlose Erbrechen: «Das Kotzen war zum Kotzen und die Glatze machte mir zu schaffen.» Sie war mit ihrer körperlichen und der psychischen Kraft am Ende. Sogar beim Trinken wurde es ihr übel. Die Kopfschmerzen und das ständige Erbrechen wollte sie nicht fünf weitere Male erleben. Christine hörte auf ihren Körper und entschied sich zusammen mit dem Onkologen für eine weniger aggressive Chemotherapie. Diese Therapie ertrug sie viel besser.
Das Kotzen war zum Kotzen und die Glatze machte mir zu schaffen
Dem fortschreitenden Haarausfall war trotz der schwächeren Dosis nicht zu entkommen. Sie machte klar, dass dies das Schlimmste für sie war: «Man erwacht und entdeckt Haarbüschel neben sich auf dem Kissen. Beim Duschen fielen mir viele Haare auf den Boden. Das tat weh. Ich hatte seit der Kindheit lange Haare und sie wurden ein Teil meiner Identität, welcher langsam verschwand.» Christine wollte dem Ausfallen nicht mehr länger zusehen und entschied sich mutig, alle Haare abzurasieren. «Es fühlte sich schlimm an. Aber ich nahm die Situation wie sie war. Ich wusste ich kann nichts ändern, akzeptierte die neue Situation und machte das Beste draus. Natürlich hat es keinen Spass gemacht in den Spiegel zu schauen, doch ich bekam viel Unterstützung von meiner Familie und meinem Freund. Dies half mir, mich mit der Zeit auch ohne Haar schön zu fühlen», teilt sie gefasst mit.
Ende gut alles gut
Die letzte Chemotherapie hatte Christine einen Tag nach ihrem Geburtstag und war anschliessend wieder «frei». Christine verlor nie ihren Humor und ihre Freude am Leben. Die positive Einstellung trug viel zur Heilung bei. Sie dankt ihrer Familie und ihrem Freundeskreis herzlich, besonders ihrer Mutter und ihrem Freund, für die Unterstützung. Dankbar äussert sich Christine: «Ich fühlte mich nie alleine.» Es machte sie reifer für das Wichtige im Leben. Stabilität, Gesundheit, Freunde, Familie und die Liebe seien für sie der Sinn des Lebens. Heute, wieder mit voller Haarpracht und strahlenden Augen, will Christine den Betroffenen raten: «Niemand soll allein durch diese Zeit. Wichtig ist es, Hilfe anzunehmen und nicht engstirnig nur den Krebs bekämpfen zu wollen. Probiere dem eigenen Körper zu vertrauen und ihn mit positiven Gedanken unterstützend zu heilen.»
Text Saina Riess


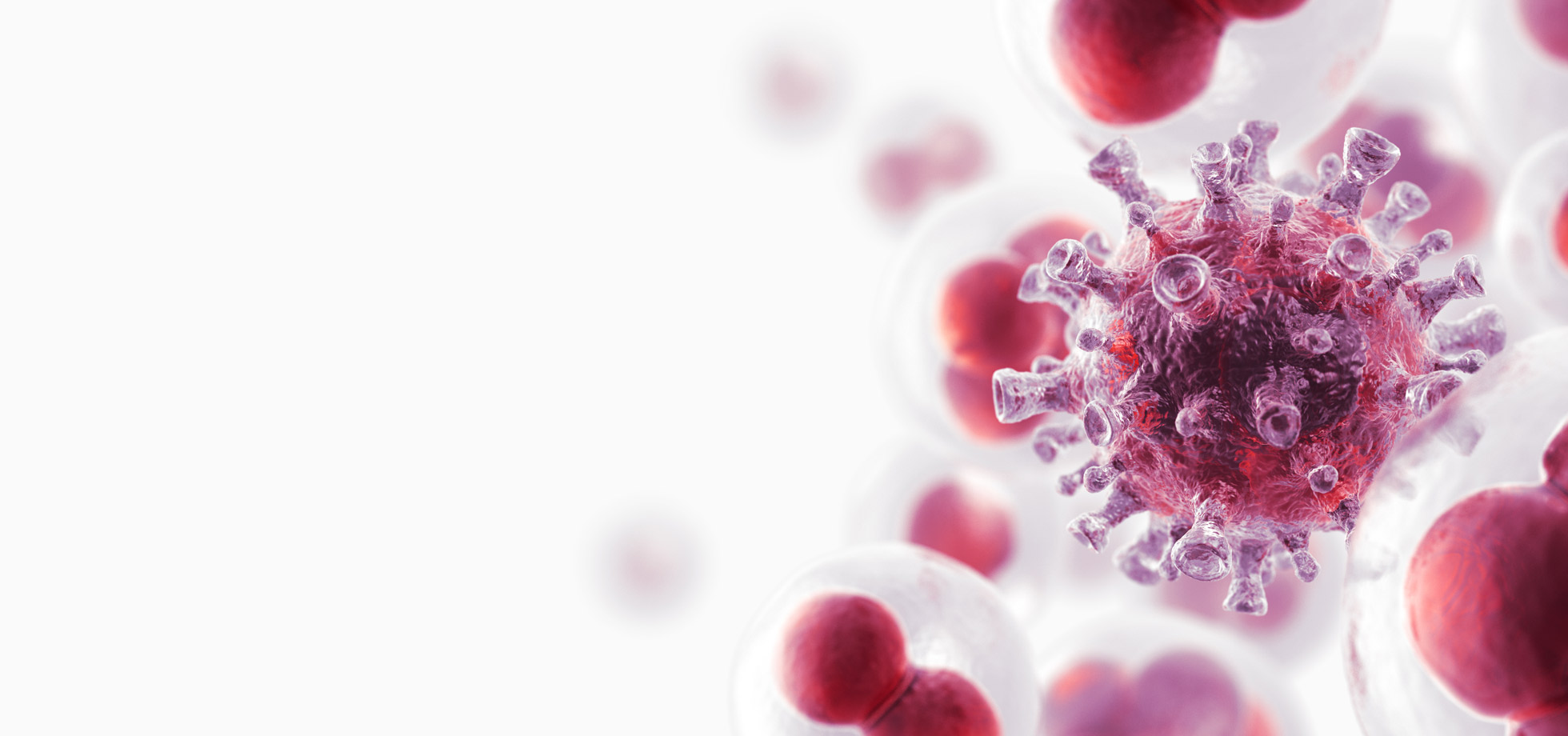
Schreibe einen Kommentar